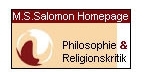Allgemeines
FAQ
Publikationen
Partner
|
Voriges Kapitel Nächstes Kapitel Inhaltsverzeichnis
III. Über die Systemtheorie der Evolution
"Makroevolution" und Evolutionsmechanismen
Evolutionsgegner behaupten in aller Regel, die Entstehung evolutiver Neuheiten sei mithilfe der Synthetischen Evolutionstheorie nicht befriedigend zu erklären. Auch zahlreiche Evolutionsbiologen kritisieren bestimmte Vorstellungen der Synthetischen Evolutionstheorie und betonen, daß die Reduktion des Evolutionsgeschehens auf rein popolationsgenetische und selektionstheoretische Aspekte unbefriedigend sei. Damit wird zwar der Sachverhalt der gemeinsamen Abstammung der Arten nicht infragegestellt, denn aus der Imperfektion der Synthetischen Theorie der Evolution ist nicht zu schließen, daß sie falsch ist, sondern nur, daß sie unvollständig ist. Dennoch gilt es, die Evolution vor dem Hintergrund neuer theoretischer Ansätze zu beleuchten und zu diskutieren, inwieweit sie die Probleme der Synthetischen Theorie besser lösen können.
1. "Makroevolution" und die Systemtheorie der Evolution
Seitdem DARWIN und WALLACE ihre Selektionstheorie der Öffentlichkeit vorstellten, wird die "äußere" oder Milieuselektion gemeinhin als die richtende Kraft im Evolutionsgeschehen verstanden, als derjenige Wirkfaktor also, der die Entwicklung der Lebewesen in eine bestimmte Richtung lenkt. Inspiriert wurde DARWIN insbesondere durch seine Beobachtungen auf den Galapagosinseln. Die Schnäbel der endemischen Finkenarten ließen eine breit gefächterte Formenvielfalt erkennen, die ihren Besitzern ein Überleben in den unterschiedlichsten Habitaten ermöglicht. Entsprechend stellt sich uns die Evolution als ein Zweistufenprozeß dar, der von Mutation und Selektion vorangetrieben wird. Mutationen erzeugen neue Zufallsvarianten, die durch die Selektion auf ihre Fitneß in einem bestimmten Lebensraum getestet werden; besser an ihre Umwelt angepasste Varianten setzen sich gegenüber den anderen durch und breiten sich in den Populationen aus. Die Organe werden so über zahllose selektionierte Zwischenstufen stufenweise verbessert, die Evolution verläuft im Rahmen dieser Vorstellung weitgehend kontinuierlich (gradualistisch).
Dieser Modus der Evolution wird in Anlehnung an HEBERER als "additive Typogenese" bezeichnet. Beobachtungen, die dieses Postulat zu stützen scheinen, findet man beispielsweise in der Fossilienreihe der Pferdefamilie oder der Rüsseltiere, wobei es sich um Evolutionsbeispiele handelt, die hinsichtlich vieler Merkmale einen weitgehend gradualistischen Verlauf aufzeigen.
Charakteristisch für diesen Prozeß sind die streng adaptationistischen Szenarien: Den Organismen fällt einerseits die Rolle der passiven Evolutionsobjekte zu, die sich an die variabilen Umweltbedingungen anpassen (adaptieren) müssen, zudem wird jede Struktur als das Resultat einer Adaptation verstanden.
1.1. Über das Konzept der "inneren Selektion"
In neueren evolutionstheoretischen Arbeiten ist jedoch wiederholt auf die Unvollständigkeit der klassischen Selektionstheorie im Hinblick auf die Erklärung der Entstehung neuer Merkmale bzw. der Formenvielfalt des Lebens hingewiesen worden. Meist wird kritisiert, daß die Organismen als "Spielbälle externer Kräfte" begriffen werden, was sie zu passiven Objekten im Rahmen des Evolutionsgeschehens macht. So schreibt etwa RIEDL zu dieser Frage:
"Ein Konzept der Phylogenie (...), das auf opportunistischer, kurzsichtiger Auswahl gelegentlicher Zufallsfehler in der Transmission von Bauvorschriften beruht, muß (...) dort versagen, wo die entstehende Gesetzmäßigkeit gewaltige, eternale Formen annimmt. Diesen ordnenden Mechanismus nicht zu kennen, bildet eine Lücke im Konzept."
(RIEDL, 1975, S. 5)
Hand in Hand mit der Kritik an der Selektionstheorie geht die Kritik am Adaptationismus. Natürlich erscheint es uns einleuchtend, daß jeder Organismus an seine Umwelt angepaßt sein muß; ein Fisch muß etwa einen stromlinienförmigen Körper besitzen, um die Fortbewegung im Wasser möglichst ökonomisch zu gestalten. Derartige Strukturen besitzen eine "Funktion" im Sinne von "Gepaßtheit" und damit einen entsprechenden positiven (externen) Selektionswert im Habitat, die Evolution wird gleichsam "von Außenfaktoren" gesteuert. Man beachte jedoch, daß Lebewesen nicht einseitig von externen Milieubedingungen beeinflußt werden, sondern daß die Ausprägung der Merkmale im Rahmen der Keimesentwicklung durch "innere Prinzipien" gelenkt wird, die gewissermaßen vorgeben, welche genetischen Veränderungen sozusagen "machbar" sind und welche hingegen letale Schädigungen des fein abgestimmten Merkmalsgefüges zur Folge haben. Die Entstehung neuer Merkmale orientiert sich mit anderen Worten an den im jeweiligen Organismus herrschenden Bedingungen und konstruktiven Zwängen, die der Evolution einerseits Beschränkungen (andererseits aber auch Chancen) auferlegen, die von äußeren Umwelteinflüssen unabhängig sind. Infolgedessen verfügt jeder Organismus über ein feinabgestimmtes "Binnenmilieu".
Im Hinblick auf die äußere (Umwelt-) Selektion bedeutet dies, daß die Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit zur Selbsterhaltung schon gegeben sein muß, bevor überhaupt eine natürliche Auslese stattfinden kann (BERTALANFFY, 1970). Im Rahmen dieser Vorstellung werden auf der molekularen, der zellulären und auf der organischen Ebene beständig Veränderungen im Hinblick auf die Lebensfähigkeit des Organismus selektiert, bevor sich die Organismen in ihrer Umwelt bewähren müssen (WUKETITS, 1988). Das Binnenmilieu ist somit als ein komplexes System von organismusspezifischen Wechselwirkungen aufzufassen, wobei die unterschiedlichen Systemebenen für die jeweils tiefergelegenen die Umwelten, welche die Selektionsbedingungen stellen, verkörpern. Zwei Zitate sollen dies verdeutlichen:
"Dabei bestimmt der Oberbegriff (das jeweilige Übersystem) die Bedeutung seiner Unterbegriffe (Untersysteme) und diese gelegentlich dessen Inhalt."
(RIEDL, 1975, S. 153)
"Organisms are not billard balls, propelled by simple and measurable external factors to predictable new positions on life's pool table. Sufficiently complex systems have greater richness. Organisms have a history that constrains their future in myriad, subtile ways (...) Their complexity of form entails a host of functions incidental to whatever pressure of natural selection superintended the initial construction."
(GOULD, 1982, S. 16)
Die Berücksichtigung der komplexen innerorganismischen Wirkungsgefüge führte zur Entwicklung der Systemtheorie der Evolution (RIEDL, 1975, 1990) sowie (unter Einbeziehung auch der neueren chaostheoretischen Erkenntnisse) zur Synergetischen Evolutionstheorie (LORENZEN, 1988), die beide als Weiterentwicklungen der Synthetischen Theorie der Evolution aufzufassen sind und das klassische Anpassungsparadigma sowie die in ihm herrschenden linearen Wirkursachenketten durch ein nichtlineares Entwicklungsszenario ersetzen. Ins Zentrum der Betrachtung rückt damit die Vorstellung von der "Mehrschichten-Selektion", die verstärkt die oben erwähnten ("inneren") Entwicklungszwänge und weniger die "äußere" (Umwelt-) Selektion als Ursache der Entwicklung und Fixierung neuer Strukturen ansieht. Ferner betonen sie die Erkennntis, daß Mutationen nicht zu Veränderungen einzelner Merkmale führen, sondern mehr oder minder das ganze System beinflussen, wobei beim Überschreiten bestimmter Schwellenwerte schon kleine genetische Veränderungen genügen können, um dramatische Veränderungen im Phänotyp hervorzurufen.
1.2. Ontogenetische "Entwicklungszwänge"
Wie wir gesehen haben, ist die Reduktion von Evolution auf den Aspekt der Umweltselektion nicht befriedigend und muß durch entwicklungsbiologische Ansätze erweitert werden. Denn heute wissen wir, daß die Übersetzung genetischer Faktoren in phänotypische einen komplexen Systemprozeß verkörpert, in dem einige durch die Expression von Genen erzeugte Stoffwechselprodukte in der Lage sind, andere Gene gezielt an- bzw. auszuschalten - die Gene sind also zu einem komplizierten "genetischen Regulationssystem" zusammengeschaltet, für den RIEDL den Begriff des "epigenetischen Systems" geprägt hat.
Einige Proteine der durch das epigenetische System bedingten Stoffwechselprozesse sind nun in der Lage, während der Embryonalentwicklung in den verschiedenen Zellen die für sie spezifischen Gene zu aktivieren und damit die Zelldifferenzierung sowie die weitere morphogenetische Entwicklung zu beieinflussen bzw. zu steuern. Die Zellen gewinnen aus dem richtungsabhängigen Konzentrationsgradienten dieser sogenannten Aktivatoren quasi "Lageinformation", was von entscheidender Bedeutung für die Entstehung von komplexer Ordnung ist (WOLPERT, 1982). Die Stoffwechselprozesse bezeichnet man in ihrer Gesamtheit als "epigenetische Landschaft" (nicht zu verwechseln mit dem epigenetischen System!) (WADDINGTON, 1970, 1982). Das epigenetische System bedingt mit anderen Worten die Gesamtheit der Stoffwechselprozesse im Organismus. Dabei kommt es systembedingt zu Kanalisierungen in der Morphogenese, also zum Befahren festgelegter "Entwicklungskanäle" in der Keimesentwicklung, die genau bestimmen, wie der "fertige" Organismus auszusehen hat.
Wie können wir uns die komplizierten systemtheoretischen Zusammenhänge anschaulich vorstellen? Wir wollen uns dazu in Anlehnung an WADDINGTON eines einfachen Modells bedienen, das die epigenetische Landschaft als gebirgige Oberflächenstruktur wiedergibt:
Stellen wir uns dazu eine von erodierenden Kräften der Natur herauspräparierte Hügellandschaft vor, in der die Berge von Spülrinnen zerfurcht, die Landschaft wiederum von tieferen und seichteren Tälern durchzogen sei. Jede Erhebung in dieser Landschaft stünde nun für ein bestimmtes Gen, dessen Basensequenz sich in der Feinstruktur des sie repräsentierenden Berges manifestiere. Alle Berge und Erhöhungen zusammen verkörpern metaphorisch gesprochen das epigenetische System, das durch sie geprägte Landschaftsrelief die epigenetische Landschaft. Die Täler, die zwischen den "Bergen" des epigenetischen Systems klaffen, durchziehen die Landschaft wie ein filigranes Kanalsystem. Im epigenetischen Modell bilden nun die regulativen Wechselwirkungen der Gene in ihrer Gesamtheit das epigenetische System. Dieses bedingt wiederum die Stoffwechselprozesse, die Individualentwicklung und damit letztlich das Aussehen der "fertigen" Lebewesen (die Phänotypen). In unserem Modell sind die Wirkketten ähnlich gelagert: Die Berge bilden in ihrer Summe das Gebirgssystem, welches seinerseits das Landschaftsrelief prägt. Der morphogenetische Entwicklungsweg entspricht nun, um im Bilde zu bleiben, dem Weg einer Kugel, welche die in unserer Landschaft befindlichen Kanäle entlangläuft.
Mit anderen Worten: Der Weg der Kugel wird durch die Landschaftsstruktur kanalisiert, wie eben die morphogenetische Entwicklung durch die epigenetische Landschaft kanalisiert und gesteuert wird (siehe Abbildung). Der Weg der Kugel repräsentiert metaphorisch gesprochen die "Bauanleitung" zur Bildung "fertiger" (adulter) Lebewesen.
Was geschieht, wenn wir das epigenetische System durch Mutationen verändern? Um die Frage beantworten zu können, brauchen wir nur unser Modell zu befragen. Durch Mutationen werden Gene verändert, wir müssen uns dazu analog die Struktur des Gebirges verändert denken:
Die "Mutationen" erzeugen in ihrer Gesamtheit mehr oder minder tiefgreifende Veränderungen in der Gebirgslandschaft. Wir können uns gut vorstellen, daß die meisten Änderungen den Weg der Kugel entweder geringfügig oder aber gar nicht beeinflussen, weil sie die Kanäle betreffen, welche die Kugel gar nicht entlangrollt: Das verhält sich aber nicht immer so. Ganz bestimmte Veränderungen in der Gebirgsstruktur - sie mögen noch so geringfügig sein - sind in der Lage, den Weg der Kugel außerordentlich stark zu beeinflussen. Manche Veränderungen werfen die Kugel völlig aus der Bahn, drängen sie in andere Kanäle ab und bewirken eine dramatische Modifikation des weiteren Entwicklungsgeschehens.
Systemveränderungen, die über kritische Bereiche hinaus erfolgen, können also unter dem Einfluß von Selektion dramatische Wandel hervorbringen, ein Szenario, das sich in vielen Systemen, in denen ein beständiger Energiefluß herrscht, abspielen kann. Diese Phänomene untersucht die Synergetik, die auch in unbelebten, energiebetriebenen Systemen (wie dem LASER) ähnliche Phänomene nachgewiesen hatte. Tatsächlich ist es bereits in Ansätzen gelungen, viele Organisationsmuster, wie etwa die Bemusterung der Zebras oder die Form des Kugelfisches auf die evolutionsbiologische Abwandlung "morphogenetische Entwicklungsfelder" zurückzuführen, wie sie durch synergetische Effekte zustandekommen (vgl. HAKEN, 2000; HAKEN-KRELL, 1987 sowie LORENZEN, 1988).
Abbildung:
Modellhafte Darstellung der epigenetischen Landschaft (nach Waddington). Ihr charakteristisches Oberflächenprofil beeinflußt den Weg einer Kugel, die in vorgegebene Kanäle bugsiert wird. Wie im Modell, so kanalisiert auch die epigenetische Landschaft die Keimesentwicklung in spezifischer Weise. Es leuchtet ein, daß manchmal schon geringfügige Veränderungen (Mutationen) die Struktur des epigenetischen Systems so verändern, daß alternative Entwicklungskanäle beschritten werden. Das Resultat ist ein ganzes Spektrum phänotypischer Veränderungen infolge der evolutiven Modifikation des Entwicklungsgeschehens und die Bildung neuer typologischer Arten.
Die Selektion bewertet nun die neu entstandenen Entwicklungswege und verwirft all diejenigen, die sich nicht als überlebensadäquat erweisen. Die "scharfe" innere Selektion schränkt damit den Evolutionsspielraum ein, es kommt neben einer Kanalisierung der Keimesentwicklung zu einer Kanalisierung der weiteren evolutiven Entwicklung, das heißt, zur Etablierung vorgegebener Evolutionsbahnen, die dem Zufall streckenweise entzogen sind.
Mithilfe der Synergetischen und der Systemtheorie der Evolution lassen sich zahlreiche Probleme und Fragestellungen lösen, die in der simplistischen Vorstellung von der additiven Typogenese nicht oder aber nur schwer erklärbar sind. Wir wollen im Folgenden etwas eingehender auf sie zu sprechen kommen.
1.3. "Makroevolution" im Lichte der Systemtheorie
Zum Verständnis der Entstehung neuer Organisationstypen
1.3.1. Das "Problem der Synorganisation" (Koadaptationsproblem)
Über die Kopplung (Systemisierung) von Genen
Teil der traditionellen Vorstellung war langezeit die "Ein-Gen-Ein-Merkmal-Hypothese", das bedeutet, jedes Gen wurde für die Ausprägung eines einzelnen Merkmals verantwortlich gemacht. Weil nun die Evolution dem Organismus adaptive Veränderungen abverlangt, kann, ja muß in diesem Kontext geradezu die Änderung jeder Einzelentscheidung erforderlich werden. Jedes Merkmal muß also unabhängig von den anderen evolvieren.
Es zeigt sich jedoch, daß viele Mutationen Veränderungen in einer Reihe von Merkmalen zur Folge haben (Pleiotropie) wie auch umgekehrt viele Merkmale durch eine Reihe von Genen determiniert werden (Polyphänie). Um eine günstige Adaptation zu erreichen, müssen daher im Regelfalle gleich bei mehreren Genen gleichzeitig chancenreiche Mutationen erfolgen, was eine Adaptierbarkeit mit steigender Komplexität der Strukturen rasch schwieriger macht:
"Die Adaptierung einer Funktionseinheit wird darum nicht nur auf eine günstige Chance, sondern sogar auf die Häufung günstiger Chancen zu warten haben."
(RIEDL, 1990, S. 122)
Auch REMANE, STORCH und WELSCH haben in der evolutionstheoretischen Synorganisation von Strukturen zu einem komplexen Funktionselement ein Problem gesehen und entsprechend festgestellt:
"Manche Apparate können durch sukzessive kleine Schritte entstehen: eine Stelle der Haut mit Lichtsinneszellen kann durch Pigmentanhäufung zu einem Augenfleck werden. In einem zweiten Schritt wird der Augenfleck zu einem Napfauge, aber dieser zweite Schritt kann nicht richtungslos an einer beliebigen Stelle erfolgen, sondern ist an den Ort des Augenflecks gebunden. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit einer Weiterentwicklung zu einem Auge stark herabgesetzt (...) Das Problem ist also: Wie wird in der Evolution das komplizierte Wirkungsgefüge, mit dem der Organismus von der Erbsubstanz aus den Organismus aufbaut, abgewandelt, wie werden neue Reaktionssysteme auf- und eingebaut?"
(REMANE et al. 1973, S. 160-163)
Es kann nun nicht überraschen, daß auch im Antievolutionismus die Frage im Zentrum steht, wie denn einzelne Mutationen die Bildung komplexer Funktionseinheiten und Regelkreise sowie kooperative Anpassungen zustande bringen könnten, eine Frage, wie sie etwa von VOLLMERT immer wieder diskutiert wird. Auch LÖNNIG, 1989 äußert sich in diesem Sinne und übt Kritik am Anpassungsparadigma der Synthetischen Evolutionstheorie:
"Wir finden serienweise anthropomorph-lineare Simplifikationen (...) Komplexe Strukturen und Synorganisationen von Auge und Gehirn werden ganz weggelassen oder (...) auf mögliche lineare Etappen beschränkt (...) die Fragen nach der Wahrscheinlichkeit und Reproduktion der Entstehung synorganisierter Augenstrukturen werden gar nicht erst gestellt."
Derartige "Koadaptationen" (Synorganisationen), wie sie in Determinationssystemen (so auch im epigenetische System) nötig werden, sind nun aber Ausdruck "redundanter (überzähliger) Mutationsentscheidungen", die durch die stufenweise Kopplung von Genen ("Systemisierung") schrittweise abgebaut werden können (RIEDL, 1990).
Denken wir uns dazu eine Struktur, zu deren evolutiver Anpassung Mutationen in fünf verschiedenen Genen statthatten. Die Chance, daß in den fünf ungekoppelten Genen unabhängig voneinander passende Mutationen zustandekommen, ist freilich sehr gering. Kommt es nun aber zu einer "Rangung" (Ordnung) der fünf Gene im Sinne einer gemeinsamen Kopplung, können viele der Einzelentscheidungen (Mutationen) vermieden werden, wir haben es mit einem Abbau von "redundanten Determinationsentscheidungen" zu tun. Dabei werden mehrere Strukturgene schrittweise unter einen "Regulator" verschaltet, wodurch sukzessive komplexere Steuerelemente entstehen. Einzelne Mutationen am "Hauptschalter" führen nun nicht mehr zur Veränderung des Expressionsmusters eines einzigen Gens, vielmehr sind von der Mutation alle gekoppelten Gene betroffen. Dies führt zu einer vielschichtigen Änderung phänotypischer Merkmale, die die benötigten Synorganisationen sicherstellen (vgl. KASPAR, 1978).
RIEDL hat nun gezeigt, daß die Systemisierung schon weniger Gene zu einem einfachen Regulationssystem unter Reduktion von Mutationsentscheidungen enorme Adaptations- und Selektionsvorteile mit sich bringt, auch deshalb, weil sich die energetischen Kosten und die Fehler-Anfälligkeit während der Replikation stark verringern lassen:
"Nachdem alle Entscheidungen in Form von Molekülen und Molekülpositionen materiell etabliert sind, entstehen mit jeder Entscheidung Kosten, Fehlerquellen und Schwierigkeiten der Anpassung. Der Abbau jeder redundanten Entscheidung muß darum Vorteile mit sich bringen: einen Evolutions- oder Adaptationsvorteil. Schon in recht einfachen Systemen wird das offensichtlich (...) Daraus folgt, daß die Vorteile schon bei ganz wenigen einsparbaren Mutationen sehr steil wachsen. So steil, daß es ganz unwahrscheinlich wäre, daß der für die Systemisierung genetischer Determinationsentscheidungen erforderliche Mechanismus noch nicht entwickelt worden wäre. Er wird, wie wir sehen werden, nachgerade erzwungen."
(RIEDL, 1990, S. 124-127)
Hervorzuheben sei, daß in der Vorstellung zunächst zufällig und schrittweise beliebige Gene unter ein Regulatorgen verschaltet werden. Dies geschieht solange, bis neue Funktionen entstehen oder bestehende Funktionen optimiert und vorteilhaft synorganisiert (zusammengeschaltet) werden. Schließlich können mehrere genetische Wirkketten selbst zu einer übergeordneten Regulationseinheit zusammengeschaltet werden, so daß schrittweise ein hierarchisch gegliedertes Epigenesesystem entsteht. Und das ist keine haltlose Spekulation, wie man immer wieder feststellen kann. So bemerkte ein Universitätsprofessor in einer persönlichen Stellungnahme:
"Wenn man mit einem Hauptschalter und einem neuartigen Funktionsprotein (z.B. einem licht-sensitiven Pigment) beginnt, kann man alle Gene unter die Kontrolle dieses Hauptschalters bringen und damit ausprobieren, ob die Augen-Funktion besser wird, im Augenblick ist man bei Drosophila bei 2000 Genen angelangt, die unter der Kontrolle von Pax6 ausgeprägt werden."
Am Beginn der Evolution steht damit eine große Zahl von nichtgekoppelten Genen. Mit zunehmender Systemisierung entsteht nun aus den vielen independenten Genen eine beständig abnehmende Zahl an unabhängigen Regulationssystemen, woraus hinsichtlich einer bestimmten Struktur ein zunehmender Adaptationsvorteil und eine steigende Realisierungschance erwächst. Besonders wichtig ist nun die Einsicht, daß die Systemisierung von Genen bei Mutationen gleich ein ganzes Spektrum phänotypischer Veränderungen zur Folge hat, womit natürlich das Synorganisationsproblem gelöst wird. UMSTÄTTER faßt die Zusammenhänge knapp und treffend zusammen und stellt den grundlegenden Irrtum der antievolutionistischen Kritik an der evolutionären Synorganisation funktioneller Einheiten nochmals klar heraus:
"Tatsächlich ist es eine Verkennung rückgekoppelter Systeme, wenn immer und immer wieder darauf hingewiesen wird, daß einzelne Mutationen unmöglich all diese Abhängigkeiten gleichzeitig berücksichtigen könnten. Das Umgekehrte ist der Fall. Fast jede Mutation beeinflußt mehr oder minder das gesamte System. Es ist vielmehr ein Phänomen der genetischen Untersuchungsmethoden, daß wir relativ häufig Gene bestimmten phänotypischen Erscheinungen zuordnen können. Es sei nur an die Schwierigkeit erinnert, Polygenie und Pleiotropie vollständig zu erfassen."
(UMSTÄTTER, 1990)
1.3.1.1. Experimentelle Belege für Synorganisationen
Um diese Zusammenhänge besser zu verstehen und empirisch zu untermauern, sind wiederholt Experimente durchgeführt worden (vgl. etwa MÜLLER, 1985). Dabei können durch gezielte Eingriffe die epigenetischen Bedingungen derart abgeändert werden, daß archaische Entwicklungsanleitungen reaktiviert werden. Man kann so Strukturen, die in der Ahnenlinie bestimmter Lebewesen eine Rolle gespielt haben, hervorrufen, wie z.B. die Erzeugung von Zähnen in Hühnerembryonen (WUKETITS, 1988).
Von Interesse sind in diesem Zusammenhang besonders aber die sogenannten Phänokopien. Wird ein Entwicklungsvorgang einer Störung ausgesetzt (etwa unter dem Einfluß eines Giftes), dann gelingt es immer wieder, den Phänzustand von bestimmten Mutationen zu kopieren (GOLDSCHMIDT, 1961). Es läßt sich zeigen, daß die durch äußere Einflüsse während der Embryonalentwicklung hervorgerufenen Anomalien zwar nicht erblich sind, daß sie jedoch anderen Bildungsabweichungen, die durch Mutationen hervorgerufen werden, gleichen, sie also kopieren.
"Bis zu den komplexesten Änderungen (...) lassen sich Spontanmutationen kopieren und darüber hinaus noch in ihre Wirkungsabschnitte und Submuster zerlegt analysieren."
(RIEDL, 1990, S. 286)
Das Ergebnis sind Muster wechselseitig miteinander verknüpfter Genwirkungen. In diesem Sinne lassen sich makroevolutive Veränderungen durch Mutationen an Regulatoren und Strukturgenen verstehen, die ein ganzes Spektrum von phänotypischen Veränderungen infolge der Abänderung von Genexpressionsmustern bedingen, bestimmte Mutationen verändern gleichsam das gesamte System.
LORENZEN berichtet nun von Experimenten an lebenden Schlammspringern, die nach mehrmonatiger Tyroxinbehandlung eine vielschichtige Wandlung erfahren: Die Brustflossen werden zu beinchenartigen Extremitäten, die Haut wird dicker, die Kiemen verkleinert, die Lungenatmung nimmt zu, die Abwesenheit von Wasser länger ertragen usw. (vgl. HARMS, 1934).
"Mit anderen Worten: In vielen Genotypen schlummern Potenzen, die wie in den aufgeführten Fällen erst durch adäquate Umweltreize realisiert werden. Andererseits können auch geringfügige genotypische Veränderungen unter bestimmten Bedingungen recht dramatische Effekte hervorrufen (...)"
(LORENZEN, 1988)
Das Experiment am lebendigen Schlammspringer zeigt, daß hier eine Reihe von Merkmalsveränderungen hervorgerufen werden kann, wie sie im Rahmen des makroevolutiven Übergangs vom Fisch zum landlebenden Amphibium erfolgen mußte (Umwandlung der Brustflossen zu beinchenartigen Extremitäten, dickere Haut, kleinere Kiemen, zunehmende Lungenatmung usw.). Interessant ist dabei der Umstand, daß im Ansatz ein ganzes Spektrum komplexer phänotypischer Veränderungen (das heißt Synorganisationen), wie sie meist beim Übergang von einem Organisationstyp zum nächsten auftreten, durch einen simplen Eingriff ins epigenetische System "kopiert" werden kann.
Diese Phänokopie einer Systemveränderung erfolgte ganz offensichtlich als Folge einer binnenmilieuspezifischen "Kanalisierung", eines "inneren Entwicklungszwangs" infolge der Tyroxinbehandlung. Es erscheint evident, daß die Wirkung des Tyroxins wiederum durch eine entsprechende synergetische Mutation "kopiert" wurde, wie sie beim Überschreiten systemspezifischer Schwellenwerte zustandekommt.
1.3.1.2. Synergetische Evolution - gibt es "Makromutationen"?
"Makroevolution" wird gemeinhin als Evolution verstanden, mit der sich umfassende Veränderungen in der Struktur der Organisationstypen vollzieht; gelegentlich wird damit der Terminus "Qualitätssprung" in Verbindung gebracht. Dieser Begriff ist jedoch etwas irreführend, denn viele Leute stellen sich darunter "Makromutationen" vom GOLDSCHMIDTschen Typ vor, die bei mehreren Genen gleichzeitig auftreten und im Phänotyp gewaltige Änderungen hin zu den sattsam bekannten "hopeful monsters" schaffen könnten. Solche typenübergreifenden "Makromutationen" gibt es aber nicht, und die Mehrzahl der Evolutionisbiologen sucht schon lange nicht mehr nach ihnen. Statt dessen gibt es immer nur kleine bis mittlere Sprünge.
Der kleinste Sprung ist eine Punktmutation. Ein mittlerer Sprung wäre beispielsweise eine Heterochronie, also eine zeitliche Verschiebung im Auftreten von Merkmalen in der Individualentwicklung, oder eine Mutation an Regulatoren, die synergetische Abänderungen hervorbringen können. Die oben besprochenen "synergetischen Mutationen" sind demnach nicht als echte Makromutationen zu verstehen, sondern als genetische Veränderungen, die gleichsam das ganze System - wenn auch in kleinen Schritten - kooperativ umbauen. Auch die "dramatischen" Veränderungen, die beim überschreiten systemeigener Schwellenwerte auftreten können, sind nicht so zu verstehen, daß quasi instantan ein völlig neuer Funktionstyp entsteht. Vielschichtige und tiefgreifende Wandlungsprozesse können jedoch - wie am Beispiel des Schlammspringers gezeigt wurde - im System durchaus auftreten.
Zusammenschau:
(1) Durch geeignete Änderungen des Binnenmilieus können vielschichtige Veränderungen der Phänotypen bedingt werden, die das ganze System in kleinen Schritten kooperativ umbauen und den Organismen in neuen Habitaten einen externen Selektionsvorteil verschaffen.
(2) Solche Systemveränderungen werden infolge des Wirkens von mehrschichtiger Binnenselektion bewertet, der evolutive Spielraum gleichsam eingeschränkt. Damit kommt es zu Kanalisierungen in der weiteren Entwicklung; der Evolution wird streckenweise der Zufall entzogen.
(3) Im Evolutionsgeschehen spielen externe Selektionsbedingungen hinsichtlich der Ausbildung neuer Phänotypen zunächst nur eine untergeordnete Rolle, Veränderungen resultieren zunächst nur aus den Eigenschaften des epigenetischen Systems.
1.3.2. Konvergenz und "Orthoevolution" systemtheoretisch beleuchtet
Lebewesen besitzen einen Gensatz, der in weiten Teilen identisch ist. Die Gene, die wir speziesübergreifend in uns tragen (das stammesgeschichtliche Erbe), beeinflussen nun die Struktur der epigenetischen Landschaft, die die Entwicklung der Lebewesen in vorgegebene Bahnen lenkt. Treten nun Mutationen auf, lenken diese die Entwicklung in eine andere der im epigenetischen System vorgegebenen Bahnen, die Entwicklungsbiologen sprechen dabei von inneren Entwicklungszwängen (sogenannten "developmental constraints") (vgl. ALBERCH, 1982).
Kurzum: Genetisch ähnliche Lebewesen verfügen über ähnliche epigenetische Systeme und die epigenetische Landschaft damit über ähnliche "Entwicklungs-Kanäle" in der Keimesentwicklung (Ontogenese).
Bestimmte Mutationen können daher speziesübergreifend die Keimesentwicklungungen in die "gleichen Bahnen" lenken, was zu vergleichbaren Phänotypen führt. Das Resultat sind konvergente Funktionselemente, wie etwa die Säulenbeine bei Elefanten und Dinosauriern. Die externe Selektion bewertet als übergeordnete Instanz die "Tauglichkeit" derartiger Phänotypen und führt bei ähnlichen Lebensbedingungen zu vergleichbaren Organen. Diese Annahme wird dadurch gestützt, daß man insbesondere bei nahe verwandten Organismen (die sich genetisch sehr ähnlich sind) recht häufig auf solche Parallelentwicklungen stößt.
Die Systemtheorie löst das Problem der Konvergenz also auf ganz elegante Weise. Während man in der Synthetischen Theorie zur Erklärung der Evolution konvergenter Baupläne "konvergente Selektionsdrücke" postulieren muß, folgt in der Systemtheorie die Konvergenz ganz zwangsläufig aus den Eigenschaften des epigenetischen Systems.
Ähnlich liegen die Dinge bei einem Phänomen, das als "Orthoevolution" bezeichnet wird: In der Evolution kann man immer wieder geradlinige Entwicklungstrends ausmachen, wie etwa die Regelmäßigkeit des Größenwachstums in der Pferdeevolution. In der Synthetischen Evolutionstheorie muß man gleichgerichtete Selektionsdrücke ("Orthoselektion") voraussetzen, um die über weite Strecken gradualistisch verlaufende Evolution zu erklären. In der Systemtheorie sind derartige Entwicklungstrends jedoch auch hier das Resultat von "Kanalisierungen" in der Entwicklung, wie sie gelegentlich aus den Eigenschaften epigenetischer Systeme resultieren:
"Riedl (1975) verweist darauf, daß lebende Ordnung sich nur auf die Ordnungsprinzipien ihrer Vorstadien aufbauen kann, da ihre Weitergabe in der Zeitachse erfolgt (...) Die historisch überkommenen Organisationsformen bedingen damit Evolutionsbahnen, die in gewisser Weise kanalisiert sind. Damit erklären sich Orthogenesen durch diesen eingeengten Evolutionsspielraum."
(KÄMPFE, 1992, S. 147)
Zweite, völlig neu bearbeitete Fassung, (c) 23.01.2002
Last update: 23.01.02
Voriges Kapitel Nächstes Kapitel Inhaltsverzeichnis (c) M. Neukamm, 30.08.2000