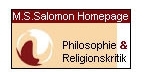Allgemeines
FAQ
Publikationen
Partner
|
Voriges Kapitel Nächstes Kapitel Inhaltsverzeichnis
V. Evolutionsbelege
3. Molekulare Ähnlichkeiten und molekulare Stammbäume
Im letzten Abschnitt haben wir erörtert, daß die zwischen den Arten zutagetretende Formenähnlichkeit eine zentrale Erwartung der Evolutionsbiologie wiederspiegelt. Die Ähnlichkeiten müssen sich bis hinab zur molekularen Ebene erstrecken, weil Evolution eben bedeutet, daß es dem Leben "erspart" bleibt, sein Gen- und Proteinrepertoire in jeder Generation von neuem zu "erfinden". Diese Einsicht hat zur Konsequenz, daß diejenigen Funktionsmoleküle, die wichtige Stoffwechselprozesse des Lebens unterhalten, bei den unterschiedlichsten Lebensformen vorkommen müssen:
"Einfach deshalb, weil sie für Lebensfunktionen so elementarer Art verantwortlich sind, daß sie schon zu einer Zeit entstanden sein müssen, in der die evolutive Aufsplitterung der Nachkommen der Urzelle in die Vielzahl der heutigen Stammeslinien noch gar nicht eingesetzt hatte!"
(v. DITFURTH, 1987, S. 42)
Solche weit verbreiteten "Funktionsträger" (z. B. Proteine) findet man tatsächlich in großer Zahl. Sie unterscheiden sich von Art zu Art etwas in ihrer Primärstruktur, weil sich nach jeder Artaufspaltung die Spezies und Proteine unterschiedlich weiter, das heißt auseinander entwickelt haben. Dabei hatten selbstverständlich nur jene Veränderungen eine Chance sich auszubreiten, die die Funktion der Proteine nicht negativ beeinträchtigten. Dies sind meist selektionsneutrale Mutationen, man spricht daher gelegentlich von "nichtdarwinscher Evolution" (KIMURA, 1987).
Es spricht nun vieles dafür, daß die Evolutionsgeschwindigkeit eines Proteins im Idealfalle konstant ist (MAIER, 1994). Daher kann man unter gewissen Voraussetzungen anhand der Zahl unterschiedlich besetzter Aminosäurepositionen einer Proteinsorte auf die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen ihren Besitzern schließen. Kurz: Proteine lassen sich im Prinzip zur Konstruktion von Stammbäumen heranziehen.
Doch inwiefern lassen sich nun diverse Proteinstammbäume als Evolutionsbelege werten? Um die Frage zu beantworten, wollen wir im folgenden auf eine Arbeit der Biologin DAYHOFF zu sprechen kommen, der es gelungen ist, die zwischen den rezenten Tiergruppen bestehenden Sequenzunterschiede beim Atmungsferment Cytochrom c in einen Stammbaum zu übersetzen (DAYHOFF, 1969). Dabei ergab sich (hier nur in Auszügen wiedergegeben) folgendes Bild:
Die Cytochrom c-Sequenzen von Schimpanse und Mensch unterscheiden sich in nur einer Position, diejenigen der Säugetiere und Vögel in durchschnittlich 9,9. Die Cytochrome c der Säuger und Amphibien differieren in etwa 14 Aminosäurepositionen. Die Cytochrome c der landlebenden Wirbeltiere unterscheiden sich vom Thunfisch an rund 18,5 und diejenigen von Wirbeltieren und Insekten an etwa 26 Stellen (Zahlen nach KÄMPFE, 1992, S. 251).Diese Zahlenverhältnisse machen deutlich, daß Mensch und Schimpanse eng miteinander verwandt sind, die Entwicklungslinien trennten sich erst vor relativ kurzer Zeit. Desweiteren stehen die Vögel den Säugetieren stammesgeschichtlich näher als die Amphibien, noch ferner stehen die Fische, und die Entwicklungslinie der Insekten trennte sich in einer noch früheren erdgeschichtlichen Periode von der Wirbeltierlinie ab.
Für unseren Gedankengang ist jetzt folgender Befund von Bedeutung: Übersetzt man die Sequenzunterschiede zwischen den Cytochromen c, aus der sich die chronologische Aufspaltungsfolge der Organismengruppen ergibt, in den entsprechenden Stammbaum, zeigt sich das Resultat, in weiten Bereichen als identisch mit demjenigen Stammbaum, den man nach der Auswertung von Fossilienfunden erstellen kann (vgl. v. DITFURTH, 1987)!
Das Spektakuläre an einer solchen Koinzidenz läßt sich erst in vollem Umfange begreifen, wenn man sich klarmacht, daß hier zwei verschiedene, scheinbar nicht in Zusammenhang stehende Arten von Datenmaterial zu mehr oder minder denselben Ergebnissen führen, ganz so, wie es die Evolutionsbiologen erwartet hatten:
"Auf der einen Seite die räumliche Verteilung versteinerter Überreste von ausgestorbenen Vorfahren heutiger Organismen, in den unterschiedlich alten Ablagerungen der Erdkruste just so verteilt, wie es ihrem entwicklungsgeschichtlichen Alter entspricht. Auf der anderen Seite der Vergleich unterschiedlicher Kopien eines sehr alten, 'fossilen' Moleküls, dessen rechnerische Auswertung zu exakt der gleichen Chronologie des Entwicklungsablaufs führt. Kann man immer noch [an der Evolution] zweifeln?"
(v. DITFURTH, 1987, S. 54 f.)
Ein solches Ausmaß an Übereinstimmung wäre, so läßt sich resümmieren, in der Tat sehr unwahrscheinlich, wenn die theoretischen Prämissen, die der Stammbaumkonstruktion vorausgehen, in entscheidenden Punkten falsch wären. Obschon wir damit natürlich keinen unumstößlichen Beweis für Evolution erbracht haben (das ist ja prinzipiell nicht möglich), müssen wir solche Koinzidenzen aus methodologischen Gründen als Stütze der DARWINschen Deszendenzlehre auffassen. Schöpfungstheorien bieten ja keine überzeugenden Erklärungen für diese Stimmigkeiten an und scheiden daher als wissenschaftliche Alternative zur Evolutionstheorie aus. (*)
Einen hohen Grad an Übereinstimmung erhält man auch, wenn man DAYHOFFs Cytochrom c- mit dem analogen Hämoglobin-Stammbaum oder mit den klassischen Ergebnissen der phylogenetischen Systematik vergleicht. MAIER stellt insgesamt fest, daß die molekulare Systematik die vergleichende Morphologie "in praktisch allen gut abgesicherten Fällen" bestätigt hat; ein Befund der völlig denkunwahrscheinlich wäre, wenn die Vertreter der Abstammungslehre einem Irrtum aufsäßen (MAIER, 1994, S. 118; vgl. Kapitel II.1).
Doch wer sich aufgrund weltanschaulicher Überzeugungen gegen diese Einsicht sperren will, läßt sich erfahrungsgemäß auch durch die methodologische Begründung nicht überzeugen. Evolutionsgegner sind daher bestrebt, die "große Reserve", die in die Ergebnisse der molekularen Systematik einkalkuliert werden muß, zu betonen. So illustrieren JUNKER und SCHERER unter anderen am Beispiel des Ferredoxins, des Cytochrom c und Hämoglobins, daß die Mutationsraten stark schwanken und widersprüchliche Stammbäume die Folge sein können. Daraus wird allgemein geschlußfolgert, daß "(...) diese Methode keine allgemein gültige, unabhängige Bestätigung der klassischen Evolutionsvorstellungen liefern kann", obgleich immerhin eingeräumt wird, daß der Cytochrom c-Stammbaum der Tiere "(...) gut mit der klassischen Taxonomie zur Deckung zu bringen ist." (JUNKER und SCHERER, 1998, S. 164-167).
Auch LÖNNIG benennt am Beispiel des Cytochrom c-Stammbaums einige konkrete "Problemfälle":
"Cytochrom-c-Unterschiede zwischen Mensch und Schnappschildkröte: 15 Aminosäurenreste; zwischen Mensch und Klapperschlange: 14 Aminosäurenreste; zwischen Schnappschildkröte und und Klapperschlange betragen jedoch die Unterschiede 22 Aminosäurenreste! Folglich ist der Mensch (Klasse Säugetiere) sowohl mit der Schnappschildkröte als auch mit der Klapperschlange näher verwandt, als die Schnappschildkröte mit der Klapperschlange (beides Reptilien). - Der Ochsenfrosch unterscheidet sich vom Menschen hier in 18 Aminosäuren, von der Klapperschlange unterscheidet er sich jedoch in 23 Aminosäuren und von der Schnappschildkröte in 10 Resten. Folglich ist der Ochsenfrosch (Klasse Amphibia) mit der Schnappschildkröte (Klasse Reptilia) näher verwandt als die letztere mit der Klapperschlange (auch Klasse Reptilia) (...) Bei vertieften Nachforschungen dürfte noch eine ganze Reihe weiterer Schwierigkeiten zutage treten."
(LÖNNIG, 1986, Kapitel V.1.1.D)
Daß Probleme in der Stammbaumrekonstruktion auftreten, ist natürlich unbestritten und bei Lichte betrachtet auch nicht verwunderlich, ist doch heute eine Vielzahl störender Einflüsse bekannt, die das "phylogenetische Signal" überspielen:
Eine Problem besteht darin, daß unterschiedliche Organismenlinien verschieden effiziente Reparaturmechanismen besitzen, so daß unterschiedlich hohe Mutationsraten möglich sind (LI und GRAUR, 1991). Desweiteren sind Mutationen oft nicht "selektionsneutral". Der verschieden große Einfluß von Selektion sowohl auf der Protein- (bzw. Gen-) wie auch auf der Organismusebene kann bei den Proteinen verschiedener Spezies zu unterschiedlichen Austausch- und Evolutionsraten führen (NEI, 1987, S. 54, 59). Unter diesen Gesichtspunkten ist es nicht überraschend, daß verschiedene Proteine unterschiedliche Stammbäume stützen können (SACCONE et al., 1995).
Allgemein ist zu beachten, daß die Zahl der nachgewiesenen Aminosäure-Austausche immer nur ein Minimum darstellt. An manchen Positionen einer Aminosäurekette können mehrere Veränderungen erfolgt sein, die aus dem Vergleich zweier Arten nicht mehr ersehbar sind (REMANE et al., 1973, S. 67). Der statistische Fehler kann bei kleinen Proteinen und geringen Sequenzunterschieden eine Auswertung erschweren oder gar unmöglich machen (JOYSEY, 1981; NEI, 1987, S. 54 f.).
Auch "nicht erkannte Formen von horizontalem (lateralem) Gentransfer" sowie Paralogie können die Ergebnisse verfälschen (MAIER, 1994, S. 118 f.). Unter lateralem Gentransfer versteht man die Übertragung von Genen von einer Art auf eine andere, wodurch Scheinverwandtschaften ermittelt werden können, die nicht die tatsächliche Evolution wiederspiegeln. Von Paralogie spricht man, wenn in einer älteren Stammart mehrere Kopien eines Gens vorlagen. Wird in den Nachfahrenlinien nur jeweils eine der Kopien "genutzt", übt die Selektion auf die anderen keinen Druck mehr aus, so daß der Vergleich solch paraloger Gene zu falschen Verwandtschaftshypothesen führen kann.
Ungeachtet aller bestehenden Probleme bei der Auswertung molekularbiologischer Daten ist einseitige Kritik jedoch fehl am Platze. Denn es läßt sich, wie wir exemplarisch aufgezeigt haben, nicht an der Tatsache rütteln, daß sich die Resultate der molekularen Systematik, vergleichenden Morphologie, Paläontologie und Biogeographie (vgl. Kapitel II.2) in vielen Fällen gegenseitig stützen. Daß dies trotz aller Unsicherheiten und Widersprüche in dem bisher erreichten Ausmaß gelungen ist, macht die DARWINsche Abstammungslehre zu einer wohlbestätigten Theorie.
Das Resultat ist nicht überraschend, denn die unerwünschten Einflüsse sind in vielen Fällen in hinreichendem Maße in den Griff zu bekommen. So besteht weitgehend Einigkeit darüber:
"(...) daß sich Probleme mit unterschiedlicher Evolutionsgeschwindigkeit, Paralogie und horizontalem Gentransfer umgehen lassen, indem man mindestens zwei verschiedene Molekülsorten zu den Berechnungen heranzieht. Als Basis dienen in der Regel 18/16S-rRNA-Stammbäume. Bei diesen Molekülen hat man die Phänomene Paralogie und horizontaler Gentransfer bisher nicht beobachtet."
(MAIER, 1994, S. 119)
Eine weitere Gruppe von Ähnlichkeitsmerkmalen, die auf eine gemeinsame Stammesgeschichte des Lebens hindeutet, sind die sogenannten Atavismen (lat. atavus: Urgroßvater, Urahn). Dabei handelt es sich um vom Artcharakter abweichende Merkmalsausprägungen bei einzelnen Individuen, um Mißbildungen, die in strukur- und lageähnlicher Weise schon bei deren Ahnen- oder Stammformen in Erscheinung getreten sind (RIEDL, 1990, S. 306).
Beispielsweise bei den Pferden kommt es gelegentlich zur Bildung von einer, in seltenen Fällen sogar von zwei überzähligen Seitenzehen ("Griffelbeinen"), die in vollständiger Weise jenen Zuständen entsprechen können, wie sie bei den Pferdevorfahren ausgebildet waren. Beim Menschen kommen gelegentlich "geschwänzte", mit einem dichten Haarkleid ausgestattete Kinder oder solche mit Halsfisteln zur Welt, die in ihrer Lage den Kiemengängen der Fische ähnlich sind. Bei Säugetieren kommen überzählige Brustwarzen (Papillen) vor, die praktisch immer entlang der "Milchleiste" ausgebildet werden, wie dies bei Säugetieren mit mehreren bauchständigen Zitzenpaaren der Fall ist. Bei Walen und Delfinen wurde die Ausbildung von Hinterextremitäten dokumentiert, die den Beinen der landlebenden Vorfahren homolog sind. Und bei der Fruchtfliege Drosophila hat man die Umbildung von Schwingkölbchen zu häutigen Hinterflügeln beobachtet, die in ihrem Phänmuster an die ersten vierflügligen Insekten erinnern.
Solche "Mißbildungen" lassen sich als Rückfälle in stammesgeschichtlich ältere Entwicklungsstadien interpretieren, die von der Existenz historisch gewordener "Organisationsmuster" zeugen und durch Mutation, durch Störungen in der Embryonalentwicklung oder durch Kreuzung wieder "reaktiviert" werden können (OSCHE, 1979, S. 28). Es es deshalb nicht überraschend, daß dieser Feststellung aus dem antievolutionistischen Lager Widerstand entgegengetragen wird.
Manchmal wird betont, daß "stillgelegte" Gene atavistischer Merkmalskomplexe vergleichsweise schnell aus dem Genbestand verschwinden müßten, weil auf sie kein Selektionsdruck mehr ausgeübt würde, der sie vor der Auflösung durch zufällig eintretende Mutationen bewahren könnte. Kein Wunder also, daß außer Funktion gestellte, scheinbar "sinnlose" Atavismen, die mit Millionen Jahre alten Ahnenformen in Zusammenhang gebracht werden, gar nicht mehr in Erscheinung treten dürften, wie JUNKER (im Kontext eines von HAMPÉ diskutierten Experimentalbeispiels) meint:
"Die atavistische Deutung würde (...) auf die Annahme hinauslaufen, daß die betreffenden Gene seit (...) Millionen Jahren stillgelegt seien. Das ist so unglaubhaft, daß dieses Argument falsifizierend für die Deutung im Sinne eines Atavismus gewertet werden muß."
(JUNKER, 2002, S. 172).
Abgesehen davon, daß solche, diversen "Ahnenmustern" entsprechende Merkmale unabhängig von der Ursachenfrage als Atavismen interpretierbar sind, daß also kausale Erklärungsprobleme (man kann dies nicht oft genug wiederholen) niemals "falsifizierend" für historische Feststellungen gewertet werden dürfen (näheres in Kapitel Ib.3), ist das Argument von geringem Gewicht. Denn bereits OSCHE hat darauf hingewiesen, daß scheinbar "sinnlose" Strukturen, oder vorsichtiger: solche, die ihre Primärfunktion eingebüßt haben, dennoch "(...) wichtige Aufgaben zu erfüllen [haben], z. B. als Organisatoren, die in benachbarten Keimregionen bestimmte Entwicklungsvorgänge induzieren (...)" (OSCHE, 1966, S. 846). Daher erscheint es durchaus plausibel, daß auch atavistische Merkmale über geologische Zeiträume hinweg im Gensystem gehalten werden, sofern die entsprechenden Gene in anderen Zusammenhängen gebraucht werden.
Die Argumentation der Evolutionsgegner ist in diesem Punkt auch deshalb inkonsequent, weil sie selbst eine ähnliche Argumentation gegen die (leider auch heute noch allzuoft) von Evolutionsbiologen getroffene Feststellung, es gäbe so etwas wie gänzlich "funktionslose" Rudimente und Embryonalstadien, anstreben (vgl. z. B. JUNKER und SCHERER, 1998, S. 169 ff.). Wer auf der einen Seite fest darauf vertraut, daß bislang noch nicht nachgewiesene Funktionen das Dasein bestimmter Keimstadien im schöpfungstheoretischen Kontext "erklären" könnten, der kann auf der anderen Seite, sobald evolutionstheoretisch argumentiert wird, nicht all das wieder vergessen und die scheinbare "Funktionslosigkeit" von Atavismen als Falsifikation der atavistischen Merkmals-Interpretation werten!
Weiterhin wird die Tatsache, daß das Auftreten einiger Atavismen als Folge einer gestörten Embryonalentwicklung (Ontogenese) verstanden werden kann, gegen die evolutionstheoretische Interpretation aufgeboten. So betont JUNKER, daß im Falle der atavistischen Hinterextremitäten beim Wal: "(...) das Stehenbleiben auf einem frühen embryonalen Stadium als Ursache für die Ausbildung von Atavismen (...) wahrscheinlich [ist]. Damit wäre ein Rückgriff auf stammesgeschichtliche Erklärung nicht erforderlich." (JUNKER, 2002, S. 177). Im gleichen Sinne begreift BLECHSCHMIDT zahlreiche Atavismen als das Resultat mehr oder minder zufällig auftretender Variationen in der Ontogenese, als "Grenzfälle des Normalen", die "(...) aus den ontogenetischen Bedingungen vollständig verstanden werden", ohne daß eine Reaktivierung evolutionär erworbener Muster angenommen werden müsse (BLECHSCHMIDT, 1985; zitiert nach JUNKER, ebd., S. 171; ähnlich JUNKER und SCHERER, 1998, S. 174).
Der Grund solcher Behauptungen ist, daß nicht erkannt wird, daß es in der "Ursachenfrage" der Biologie zwei verschiedene Erklärungsebenen gibt, die nicht miteinander verwechselt werden dürfen (MAYR, 1964; OSCHE, 1982). BLECHSCHMIDT und JUNKER ist es zwar gelungen aufzuzeigen, daß einige Atavismen unmittelbar durch Störungen in der ontogenetischen Entwicklung verursacht werden ("proximate cause"). Darüber wird aber offenbar vergessen, daß die Entwicklungen nur innerhalb eines "genetischen Systems" ablaufen können, das entweder die Potenz zur Bildung solcher Ahnenmuster bereits enthält oder sie in der Keimesentwicklung rekapituliert.
Nach der Entstehungsursache des Gensystems und dessen Eigenheiten wird hier aber gerade gefragt, so daß zu einem umfassenden Verständnis der Formbildung auch "höhere" Ursachen historischer Natur gehören ("ultimate causes"), die "(...) durch das die Ontogenese steuernde genetische Programm gegeben [sind] (...)", und historisch (selektionsgelenkt) entstanden sind (OSCHE, 1982, S. 12).
An dieser Stelle müssen wir den Evolutionsgegnern konzedieren, daß nicht ausschließlich Evolution, sondern auch Schöpfung als "ultimate cause" infragekommen könnte, denn aufgrund des Erkenntnisproblems fehlen hier die zwingenden Argumente. Das gilt aber auch für alle anderen Wissenschaftsbereiche, und dieser Aspekt macht wieder einmal deutlich, daß die Kontroverse nicht rein erkenntistheoretisch geführt werden kann (wie dies zahlreiche Antievolutioniten immerzu glauben), sondern daß sie sich immer auf der Boden der Wissenschaftstheorie bzw. Methodologie rückzubesinnen hat. Dabei gilt es in erster Linie zu bedenken, daß das vorrangige Ziel der Wissenschaft darin besteht, unverstandene Erscheinungen einer bestmöglichen Erklärung zuzuführen (VOLLMER, 1985, S. 277). Eine Erklärung ist, um unseren Ausführungen vorzugreifen, die Schöpfungstheorie aber nicht zu liefern imstande, so daß sie auch nicht als wissenschaftliche Alternative in Betracht zu ziehen ist.
Da hilft es dem Evolutionskritiker zunächst einmal wenig darauf hinzuweisen, daß Mißbildungen nur in "Ausnahmefällen" als Atavismen interpretiert und erklärt werden könnten, weil in den meisten Fällen einfach nur (als Folge einer "homöotischen Mutation") eine im Organismus bereits vorhandene Struktur an einer anderen Stelle des Körpers nochmals zur Ausbildung kommt. Als das Resultat solcher Doppelbildungen könnten, so wird gemutmaßt, beispielsweise die Hinterextremitäten der Wale und die überzähligen Seitenzehen des Hauspferdes verstanden werden, wodurch sie natürlich sofort aus der Gruppe der evolutionsbiologisch relevanten Atavismen ausgeschieden wären:
"Sie [die Hinterextremitäten der Wale] lassen sich (...) als mißgebildete 'Kopien' von Teilen der Vorderextremitäten deuten. Daher ist es nicht zwingend, eingeschlafene Gene zu postulieren, die 'versehentlich' reaktiviert werden und dadurch zum Auftreten von Atavismen führen."
(JUNKER und SCHERER, 1998, S. 174)
Sicher ist, das sei unseren Kritikern zugestanden, die Unterscheidung zwischen Atavismen und "bloßen Fehlern" oft schwierig, und so manch als Atavismus geglaubtes Merkmal mag sich im Nachhinein als einfache Miß- und Doppelbildung herausgestellt haben. Jedoch, auch das sei betont, bleiben genügend signifikante Beispiele übrig, die unter die evolutionshistorische Erklärung subsummiert werden können.
Bei aller berechtigten Kritik wird einfach nicht zur Kenntnis genommen, daß die meisten der sogenannten"spontanen Atavismen" nur schwerlich als Doppel- und Ersatzbildungen interpretiert werden können, wie RIEDL meines Erachtens zurecht festgestellt hat (vgl. RIEDL, 1990, S. 284). Hier haben wir es nämlich nicht einfach nur mit "Kopien" von im Organismus regulär an anderen Stellen schon vorhandenen Phänmustern zu tun, sondern mit Merkmalen, die in zahlreichen Charakteren derart aufeinander abgestimmte Veränderungen erfahren haben, daß "sinnvoll" organisierte Strukturen, die bereits bei den Ahnen der betreffenden Individuen in ähnlicher Weise realisiert waren, zum Vorschein kommen.
Das vielleicht augenscheinlichste Beispiel eines spontanen Atavismus ruht in der Mutante des dreizehigen Pferdes: Die zusätzlich ausgebildeten Seitenzehen weisen nicht nur hinsichtlich der Knochenzahl, der Gelenke und Insertionsstellen genau dieselben Verhältnisse auf, wie man sie noch bei den fossil erhaltenen Pferdevorfahren vorfindet, auch die zugehörigen Muskeln sind noch funktional und lagegerecht angeordnet (RIEDL, a.a.O.). Man sieht hier, wie auch in vielen anderen Fällen, daß zahlreiche Charaktere von bereits "ausrangierten" Merkmalskomplexen struktur- und lagegerecht wieder zusammengetragen werden.
Liefert das "Schöpfungsparadigma", so ist jetzt unter methodologischen Gesichtspunkten zu fragen, eine wissenschaftliche Erklärung für diesen merkwürdigen Befund? Kommt sie mit anderen Worten als wissenschaftlich tragfähige Alternative zur Evolutionstheorie in Betracht? Diese Fragen muß der Wissenschaftler aus folgenden Gründen verneinen:
Zum einen läßt sich, wie wir oben erörtert haben, nicht aus den "entwicklungbiologischen Randbedingungen" heraus verstehen, weshalb das epigenetische System just so "konzipiert" wurde, daß in ihm die Potenz zur Bildung solch beeindruckender Strukturähnlichkeiten enthalten ist (das epigenetische System kann ja nicht seine eigene "Vorgeschichte" erklären). Und wer hier das Wirken eines Schöpfers als Finalursache postuliert, hat die Frage nur auf eine "höhere Ebene" ausgelagert, aber nicht überzeugend erklärt, warum der Schöpfer die Möglichkeiten zur Bildung solcher Ähnlichkeiten in das Gensystem "hineingelegt" und über geologische Zeiträume hinweg bewahrt haben soll.
Auch der mögliche Einwand, daß der Kreator beim Erschaffen der Arten eben auf bestimmte funktionale Zwänge Rücksicht zu nehmen hatte, wodurch Systembedingungen entstanden sind, die die Potenzen zur "atavistischen" Formbildung latent mit sich führen, liefert keine Erklärung. Denn ein Schöpfer kann prinzipiell alles und muß deshalb auch auf keine innerweltlichen Gesetze und Zwänge Rücksicht nehmen, die - will man den Evolutionsgegnern Glauben schenken - ja von ihm selbst eingerichtet worden sind!
Damit kommt dem Evolutionsgegner meines Erachtens nur noch der Zufall zupaß, demzufolge die morphologischen Übereinstimmungen einfach als das Resultat mehr oder minder wahllos auftretender Variationen, eben als zufällige Entwicklungsstörungen zu interpretieren sind, die keinen Sinn machen. Beim tieferen Nachdenken scheidet aber auch diese Interpretation als Erklärung aus, denn:
"Wenn wir berechnen, mit welcher Zufallswahrscheinlichkeit zu erwarten wäre, daß solche, den alten Mustern ähnlichen Bildungen durch den Zufall zusammengefügt werden könnten, wenn wir also die Mutationswahrscheinlichkeit mit der Anzahl der abgestimmt veränderten Einzelmerkmale potenzieren, dann sehen wir sofort, daß das Wirken des Zufalls ganz auszuschließen ist. Tatsächlich kann man nur auf das Umschalten auf ein konserviert erhaltenes altes Muster von Determinationsentscheidungen schließen."
(RIEDL, 1990, S. 308)
Wen das alles noch immer nicht überzeugt, der sei darauf hingewiesen, daß es auch atavistische Merkmale gibt, deren Geschichte noch offensichtlicher aus der Struktur rekonstruierbar ist. So kennt man beispielsweise Kakteen mit atavistisch angelegten Blättern und ohrenlose Robben mit atavistischen Ohrmuscheln. Daß hier alte genetische Programme wieder in Betrieb genommen werden, legt die Konstruktion nahe. Selbst JUNKER räumt ein, daß die Schöpfungstheorie im Hinblick auf derartige Strukturen in Erklärungsnöte gerät (JUNKER, 2002, S. 177).
Wie man es auch dreht und wendet, das Auftreten solcher Merkmale vermag nur derjenige sinnvoll zu erklären, der die gemeinsame Stammesgeschichte als wohlbestätigtes Faktum anerkennt. Deshalb kann aus wissenschaftstmethodischen Gründen die Schöpfungstheorie nicht als ernstzunehmende Alternative der Evolutionstheorie infragekommen.
_____________________________________________
Insgesamt läßt sich feststellen, daß es der Schöpfungsalternative unmöglich ist, die Realhistorie anhand theoretischer Vorgaben zu rekonstruieren und das Resultat dann z. B. paläontologisch oder biogeographisch abzustützen, wie dies den Evolutionsbiologen gelungen ist. Daß es überhaupt so etwas wie eine gewinnbringende Rückkopplung zwischen Schöpfungstheorien und verschiedenen Wissenschaftsbereichen gibt, ist von Schöpfungstheoretikern bislang noch nicht aufgezeigt worden. Das wäre aber dringend erforderlich, um ihren heuristischen Wert und damit ihre Wissenschaftlichkeit unter Beweis zu stellen (vgl. Kapitel Ia.1). Die Feststellung, daß die Ergebnisse der vergleichenden Biologie und Paläontologie auffallend oft miteinander korrespondieren, muß der Schöpfungstheoretiker unerklärt zur Kenntnis nehmen.
Zweite, völlig neu bearbeitete Fassung (c) 05.04.2003
Last update: 05.04.03
Voriges Kapitel Nächstes Kapitel Inhaltsverzeichnis (c) M. Neukamm, 30.08.2000